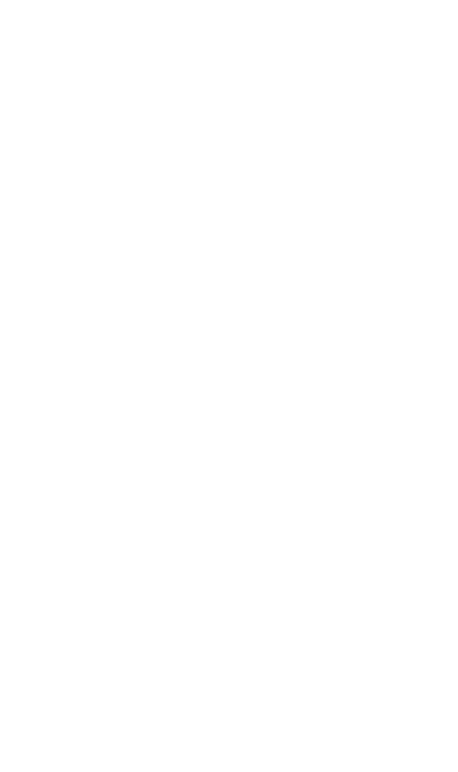AvS – International Trusted Advisors: „Diversity” ist ein in der Geschäftswelt intensiv diskutiertes Thema. Von welchen wirtschaftlichen Vorteilen profitieren Unternehmen, die sich dem Aufbau von Top-Teams mit einem hohen Grad an Vielfalt verschrieben haben?
Dr. Michael Hathorn: Der Business Case hierfür hat sich seit einiger Zeit etabliert und ist ziemlich überzeugend. Dies wird durch eine große Anzahl von Studien gestützt, die nachweisen, dass Beiräte mit höherer Geschlechtervielfalt stark korrelieren mit einer besseren Performance bei den typischen finanziellen Kennzahlen. Das Credit Suisse Research Institute zeigte beispielsweise auf, dass Unternehmen mit einem höheren Anteil an Frauen in Entscheidungsprozessen höhere Eigenkapitalrenditen erzielen und eine konservativere Bilanz führen. Andere Studien bestätigen, dass Unternehmen, in denen Frauen die Mehrheit des Top-Managements bilden, ein höheres Umsatzwachstum, höhere Cash-Flow-Renditen auf Investitionen und eine geringere Verschuldung aufweisen. Mit nur einer Frau im Beiratsgremium besteht die Gefahr, dass diese lediglich als „symbolisch“ wahrgenommen und ihre Meinung dementsprechend nicht ausreichend berücksichtigt wird. Diesen Effekt kann man nur überwinden, in dem man eine kritische Masse erreicht. Der größte Einfluss auf die finanzielle Leistung wird in denjenigen Unternehmen gemessen, die drei oder mehr Positionen in ihrem Beirat mit Frauen besetzten.
Was steckt hinter dieser Korrelation zwischen weiblichen Führungskräften und der Verbesserung der Geschäftsleistung?
Entscheidungsfindungs- und interne Teamprozesse scheinen fundierter zu sein, wenn eine erhebliche Beteiligung von Frauen vorliegt. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Frauen tiefgreifendere Debatten über entscheidende Themen anregen und geschlechterdifferenzierte Teams innovativere Lösungen entwickeln – entscheidende Kompetenzen, um in der heutigen, turbulenten Zeit zu überleben und strategisch wirkungsvoll zu agieren. Darüber hinaus haben Frauen bei Beiratssitzungen eine höhere Anwesenheitsrate als Männer. Sie setzen hierdurch eine neue Norm für den Beirat, in Folge derer auch die Teilnahmequote der männlichen Beiratsmitglieder steigt. In Krisenzeiten gibt es unter weiblicher Führung auch weniger Streiks und Entlassungen, also Maßnahmen, die für Unternehmen auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Ein anderer, vielleicht subtilerer Effekt ist die Verbesserung der Reputation eines Unternehmens. Viele Unternehmen werden von ihren verschiedenen Stakeholdern stark unter Druck gesetzt, ihre Beiräte zu diversifizieren. Folglich wird solch ein Unternehmen für weibliche Führungskräfte, die eine vielfältige Herangehensweise schätzen, deutlich attraktiver. Dadurch erhalten diese Unternehmen einen bevorzugten Zugang zu einem viel größeren Pool an Talenten. Auch diese Effekte treten jedoch erst ein, wenn man mehr als nur eine Frau im Beirat hat.
Wenn die Vorteile so überzeugend sind, warum sind die Beiräte vieler Unternehmen heute immer noch sehr einseitig besetzt?
Es gibt eine Reihe systembedingter Probleme, die außerordentlich schwer zu überwinden sind. Zunächst einmal ist Kultur sehr beständig, was Veränderungen generell erschwert. Im Laufe der Zeit reproduzieren und verfestigen sich Rekrutierungsprozesse und bestimmte Verhaltensweisen bei der Zusammensetzung des Beirats, weshalb dieser am Ende immer sehr ähnlich aussieht. Zusätzlich können wir bei der Personalauswahl das Phänomen des „Klonens“ beobachten. Menschen neigen dazu, sich im Kreis von Personen, die ihnen ähnlich sind, wohler zu fühlen – was folglich die Auswahl männlicher Beiratsmitglieder verstärkt. Ein weiteres wichtiges Problem besteht darin, dass die in einem Unternehmen verfügbaren Talente mit steigender Hierarchieebene zunehmend männlich werden. Dies führt dazu, dass die Auswahl an möglichen Führungskräften für Positionen im oberen Management überwiegend männlich ist. Es gibt jedoch genug qualifizierte Frauen, die an die Spitze eines Unternehmens kommen könnten. Zwar ist beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach wie vor eine große Hürde für Frauen, die die Karriereleiter aufsteigen und sich für ein Beiratsmandat qualifizieren wollen. In der Regel erleben weibliche Führungskräfte diese Herausforderung jedoch nur über einen sehr kurzen Zeitraum ihres Arbeitslebens, vielleicht nur 10-20% einer 40-jährigen beruflichen Karriere. Wenn Sie eine weibliche Führungskraft identifiziert haben, die Ihr Unternehmen maßgeblich voranbringen kann, sollten Sie diesen Zeitraum mit kreativen Lösungen überbrücken und die Person somit an sich binden.
Sind die spezifischen Werte und die langfristige Ausrichtung von Familienunternehmen ein Vorteil beim Aufbau vielfältiger Teams im Vergleich zu börsennotierten Unternehmen, die möglicherweise einem stärkeren Druck ausgesetzt sind?
Mit Blick auf die Werte stimmt diese Hypothese nicht mit meinen Erfahrungen überein. Ich habe mit einigen Familienunternehmen zusammengearbeitet, in denen eine Verschreibung patriarchalischer Werte dazu geführt hat, dass ein weniger talentiertes Familienmitglied aufgrund seines Geschlechts eine Führungsposition einnimmt. Ich stimme jedoch zu, dass Familienunternehmen oft eine längerfristige Orientierung auf das Geschäft ausüben können, da sie frei von den kurzfristigen Marktbelastungen börsennotierter Unternehmen sind. Unabhängig von der Art des Unternehmens ist es im Allgemeinen sehr schwierig für Unternehmen, ihre Kultur zu verändern und sich an die Herausforderungen der heutigen Welt anzupassen. Dennoch glaube ich, dass Kultur ein wichtiger Antrieb für strategische Vorteile sein kann. Google beispielsweise ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich durch ein Angebot an Kinderbetreuung, flexiblen Arbeitszeiten, Freizeitaktivitäten und vielen anderen Vorteilen auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter eingestellt hat. Die Leistungsstandards sind dennoch sehr hoch und das Führungspersonal wird im Hinblick auf die erbrachten Leistungen ausgewählt. Viele Unternehmen setzen auch heute noch Präsenz mit Leistung gleich und erkennen nicht, dass Mitarbeiter eine flexible Arbeitsumgebung, in der die Qualität ihrer Arbeit die entscheidende Größe ist, schätzen und sich dadurch noch stärker für das Unternehmen einsetzen. Unternehmen sollten moderne Technologien nutzen, um die Flexibilität zu erhöhen und die Arbeitsumgebung anzupassen – mit anhaltendem Fokus auf Leistung.
Das „Nordische Modell“ wird oft als das beste Beispiel für eine Region mit einer geschlechterdifferenzierten Beiratslandschaft angeführt. Was haben die skandinavischen Länder richtig gemacht?
Von Anfang an strebten die nordischen Länder danach, ihre Governance-Richtlinien im Einklang mit globalen „Best Practices“ zu entwickeln. Sie integrierten einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der weit über die reine Profitabilität hinausgeht. Durch die Einbeziehung verschiedener Interessengruppen und ihrer gegenseitigen Verantwortung wurde das Thema auf eine soziale Ebene gehoben und ganzheitlich diskutiert. Im Falle Norwegens wurde argumentiert, dass geschlechterdifferenzierte Beiräte sowohl für das Land als auch für Unternehmen wichtig sind. Wenn nur die Hälfte des verfügbaren Talentpools genutzt wird, wird das Land globale Wettbewerbsnachteile erfahren. Wenn ein norwegisches Unternehmen vom Aktienmarkt profitieren möchte, muss es auf alle zur Verfügung stehenden Talente zurückgreifen – und das gilt auch für die Besetzung von Beiratspositionen.
Die nordischen Länder setzen auch obligatorische Quoten ein, um die Geschlechtervielfalt zu erhöhen. Was spricht für, und was gegen die Festlegung solcher Quoten für Beiräte, und sollten diese verpflichtend sein?
Meiner Ansicht nach sind freiwillige Quoten oder Zielvorgaben als erster Schritt zur Förderung des Wandels vorzuziehen – und bei unzureichenden Fortschritten um obligatorische Quoten zu ergänzen. Auch in Norwegen wurde zu Beginn kein Gesetz erlassen, das die Zusammensetzung von Beiräten regelte. Vielmehr wurden die Unternehmen ermutigt, freiwillig zu handeln. Erst zwei Jahre später, als es nur wenige Fortschritte gab, wurde das Gesetz implementiert. Binnen sehr kurzer Zeit haben die Beiräte norwegischer börsennotierter Unternehmen ihre Geschlechtervielfalt dann um bis zu 40% gesteigert. Der Hauptnachteil, den wir dabei beobachten konnten, war das Phänomen des „Over-Boarding“: Aufgrund des schnellen Wandels waren Frauen in mehreren Beiräten parallel aktiv und haben sich damit ein wenig übernommen. Eine Reihe von Studien kam jedoch übergreifend zu dem Schluss, dass die befürchteten Konsequenzen, beispielsweise dass die Unternehmen hinter den Erwartungen zurückbleiben oder weibliche Führungskräfte nicht erfahren genug sind, sich als unberechtigt erwiesen haben.
Welchen Karriereratschlag würden Sie weiblichen Führungskräften geben, die gerne in Beiräten aktiv werden möchten?
Weibliche Führungskräfte müssen zunächst Führungserfahrung aufbauen, wenn möglich international. Das Sammeln von Expertise in Positionen mit Ergebnisverantwortung lässt sich durch nichts ersetzen. Des Weiteren müssen sie hinterfragen, was sie dazu bewogen hat, eine Beiratsposition anzustreben – und auch in der Lage sein, ihre Motive zu artikulieren. Es ist sehr wichtig für weibliche Führungskräfte, ein umfangreiches Netzwerk aufzubauen und ihre Fähigkeiten in einem breiten Markt aktiv zu kommunizieren. Dazu gehört der Beitritt zu bestimmten Gruppen und die Teilnahme an Veranstaltungen, die überwiegend männlich sind, um dort in Gesprächen ihre Leistungen und Ziele deutlich zu machen – eine für Frauen eher untypische Verhaltensweise, die sie aber dennoch adaptieren müssen, um signifikante Wirkung in der männlich dominierten Geschäftswelt zu entfalten.
Bisher haben wir hauptsächlich über die Geschlechtervielfalt gesprochen. Ist dieser Schwerpunkt gerechtfertigt, oder sollten Beiräte im Kontext der Vielfalt noch umfassender und ganzheitlicher denken?
Meiner Meinung nach müssen wir den Schwerpunkt auf das Geschlechtergleichgewicht legen. Frauen sind ein grundlegender Aspekt der Vielfalt – und sie sind unterrepräsentiert. Indem wir uns darauf konzentrieren, mehr Frauen in Beiratspositionen zu bringen, werden auch andere Aspekte der Vielfalt gestärkt: Vielfalt an Gedanken, Denkweisen, Erfahrungen, Stilrichtungen usw. Gleichzeitig muss die Rekrutierung von Beiratsmitgliedern jedoch immer von den Bedürfnissen des Beirats bestimmt werden. Es ist wichtig, dass Unternehmen die Diversifizierung des Beirats nicht als eine Compliance-Übung betrachten, sondern als Bemühung, die beste Person für die Aufgabe zu verpflichten – die eben zufällig weiblich ist. Gleichzeitig müssen wir uns der Notwendigkeit von Ethnizität und Nationalitäten in unseren Beiräten bewusst sein – wiederum nicht wegen politischer Korrektheit, sondern weil die Beiratszusammensetzung die Geschäftstätigkeit reflektieren sollte. Wenn Sie global tätig sind, müssen Sie bestimmte Kenntnisse in Bezug auf Ihre wichtigsten Regionen haben. Dies erhöht die Möglichkeit des Unternehmens, in diesem Geschäftsfeld bessere Leistung zu erzielen.
Wir leben in Zeiten, die als „VUCA“ beschrieben werden – „Volatile“ (volatil), „Uncertain“ (ungewiss), „Complex“ (komplex) und „Ambiguous“ (mehrdeutig). Die Geschwindigkeit des Wandels und der Erfolgsdruck nehmen immer stärker zu. Wie können Beiräte mithalten, sich anpassen und relevant bleiben?
In einem hochgradig volatilen Umfeld wird Führung am besten durch Visionen und Werte statt durch ausgefeilte strategische Pläne ausgeübt. Wir müssen unsere Annahmen ständig hinterfragen und bereit sein, unsere Pläne zu ändern, wenn dies gerechtfertigt ist. Ungewissheit und Komplexität erfordern, dass sich Führungskräfte und Beiratsmitglieder sehr intensiv mit mehreren Ebenen in der Organisation vernetzen, um funktionsübergreifende Entscheidungen zu treffen, die für das gesamte Unternehmen gelten. Und Ambiguität ist letztlich eine Aufforderung, Innovationen voranzutreiben und neue Wege zu gehen. Beiräte müssen Mitglieder gewinnen, die diese umfassende Expertise mitbringen und unternehmensweit agieren können. Sie brauchen Teamplayer, die vollständig engagiert und bereit sind, eine tiefgreifende und sinnvolle Debatte zu führen. Bisher habe ich nicht das Gefühl, dass Unternehmen genug tun, um die Herausforderungen einer „VUCA“-Umgebung zu bewältigen. Die starke Fokussierung von Beiratsmitgliedern auf die eigene Verantwortung und Expertise führt häufig dazu, dass sich Beiräte zu sehr vom eigentlichen Geschäft entfernen. Bei ernsthaften Herausforderungen werden diese Schwächen sehr deutlich.
Wie stellen Sie eine gute Zusammensetzung und Chemie im Beirat sicher, damit die richtige Mischung aus Hintergründen, Fachwissen, Perspektiven und Persönlichkeiten entsteht?
Zunächst muss man Klarheit schaffen über die spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die jedes Beiratsmitglied einbringen soll. Dazu gehört auch die Abschaffung von externen Kriterien, die ggf. keine wesentlichen Auswirkungen haben, wie beispielsweise eine vorherige CEO-Tätigkeit. Letzteres ist für mich fast ein „Nicht-Kriterium“, weil eine Vielzahl von Führungskräften beweisen kann, dass sie während ihrer Karriere einen ganzheitlichen Blick auf das Geschäft gewonnen haben. Auch muss man die Rolle definieren, die das zukünftige Beiratsmitglied einnehmen soll. Es kann sinnvoll sein, dass ein weibliches Beiratsmitglied den Vorsitz im Nominierungsausschuss übernimmt, wenn das Unternehmen sein Spektrum möglicher Beiratsmitglieder erweitern möchte. Dann muss man demografische Daten und verschiedene Aspekte von Vielfalt wie Alter, Geschlecht, Ethnie und Nationalität berücksichtigen, um alle Bereiche des Geschäfts repräsentieren zu können. Schauen Sie sich die Automobilindustrie an: Einige Unternehmen haben lange gebraucht, um zu verstehen, dass Frauen beim Kauf eines Autos eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. Hätten sie frühzeitig weibliche Beiratsmitglieder, die über entsprechendes Marketingwissen und Verständnis für das Kaufverhalten verfügen, in ihre Überlegungen involviert, hätten die Konzerne niemals die Rolle und den Einfluss von Frauen im Automobilkauf übersehen. Die verschiedenen Anforderungen an Vielfalt in Zusammenspiel mit den Bedürfnissen des Geschäfts zu priorisieren hilft, einen klaren Fokus zu setzen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Am Ende ist es eine Frage des Talents und der Kompetenz, keine Frage des Geschlechts.
Was sind die notwendigen Grundregeln für eine dynamische und höchst effektive Zusammenarbeit eines diversifizierten Beirats?
Die aktuelle Forschung kommt zu dem Schluss, dass ein hohes Maß an Vertrauen unerlässlich ist, um offene Debatten zu führen und seine Meinung zu äußern. Wenn ein Beiratsmitglied nicht an der Entscheidungsfindung teilnimmt, hat es natürlich Vorbehalte und wird letztendlich nicht hinter der Entscheidung stehen. Das reduziert wiederum die Rechenschaftspflicht und wirkt sich letztlich negativ auf die Ergebnisse aus. Um ein Umfeld zu schaffen, in dem Ideenkonflikte gefördert werden, ist es unerlässlich, eine Team-Charta oder ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, das die Mission, Richtlinien und Erwartungen an die Teamkultur und die Beiträge der Teammitglieder festhält. Der wichtigste Einfluss ist jedoch das Verhalten und die Interaktion des Beiratsvorsitzenden, der ständig seine eigene Mission und Leistung hinterfragen muss, um ein Team aufzubauen, das bestrebt ist, die Ideen aller zu verbessern, zu reflektieren und einzubeziehen. Ein Beirat muss klare Kriterien für seine eigene Leistung und die Leistung seiner Mitglieder haben – und muss sich regelmäßig selbst auf Basis dieser Erwartungen überprüfen.
Wie sollte diese Überprüfung bzw. Beurteilung am besten durchgeführt werden?
Es gibt keinen „one size fits all“-Ansatz, um die Leistung eines Beirats zu überwachen oder zu bewerten. Es ist wichtig, dass Beiräte eigene Selbstüberwachungsmechanismen für die Leistung der Gruppe sowie einzelner Mitglieder entwickeln. Dies kann mit oder ohne die Hilfe eines externen Beraters geschehen. Für die individuelle Leistung empfehle ich immer eine Selbstevaluation, die auf Gesprächen mit dem Beiratsvorsitzenden und den anderen Mitgliedern basiert. Der Vorsitzende muss diese Selbstevaluation dann bestätigen und erweitern – und mögliche Schwachpunkte aufzeigen. Es ist erstaunlich, wie viele Beiräte keinen strukturierten Evaluierungsprozess eingerichtet haben, da dieser als eher negativ, schwer und fast Compliance-getrieben angesehen wird. Aber der Zweck ist vielmehr, eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu schaffen, um ein effektiveres Beiratsmitglied und ein effektiveres Beiratsgremium zu werden.
Haben Sie einen letzten Ratschlag zum Thema „Vielfalt“ für Beiratsvorsitzende und CEOs, die dieses Interview lesen?
Geschlechtervielfalt sollte als Chance zur Verbesserung der Beiratsleistung und zur Schaffung eines erheblichen zusätzlichen Geschäftswerts gesehen werden – und nicht als eine Übung in „Political Correctness“. Die Unternehmenseinstellung muss sich dahingehend ändern, dass die Relevanz vielfältiger Top-Teams verstanden und in die Unternehmenskultur übernommen wird. Das ist der Schlüssel! Und niemand kann dabei eine so große Wirkung entfalten wie der Beiratsvorsitzende und der CEO. Ich habe mit einer Reihe von Beiratsmitgliedern und -vorsitzenden gesprochen, die der Geschlechtervielfalt in ihren Gremien anfangs sehr skeptisch gegenüberstanden. Nachdem sie jedoch von den Möglichkeiten und Wirkungen eines diversifizierten Beirats erfahren haben, waren sie bestrebt, diesen Wandel auch zu fördern. Wenn alle CEOs die Vorteile eines vielfältigen Teams erkennen würden, bräuchten wir keine Quoten.
Herr Dr. Hathorn, wir bedanken uns für diese Einblicke!
Dr. Michael Hathorn ist Professor an der Arizona State University und der Thunderbird School of Global Management. Darüber hinaus ist er Partner im Bereich Board Development am International Center for Corporate Governance und lehrt Leadership-Governance im DAS-Programm für Sustainable Business – ein gemeinsames Programm der Universität St. Gallen und der Business School Lausanne.






 In eigener Sache
In eigener Sache




 Unternehmensführung 4.0
Unternehmensführung 4.0 Digitale Beiratsmitglieder
Digitale Beiratsmitglieder  Noch nie hat sich die Branche so dramatisch schnell gewandelt
Noch nie hat sich die Branche so dramatisch schnell gewandelt




 Die zentrale Rolle der Eigentümerstrategie
Die zentrale Rolle der Eigentümerstrategie






 Finden und Binden
Finden und Binden Fremdmanager: Die Suche nach großen Talenten mit kleinem Ego
Fremdmanager: Die Suche nach großen Talenten mit kleinem Ego

 Die “Benefit Corporation”
Die “Benefit Corporation” Zum Wohle von Gesellschaft und Gesellschaftern
Zum Wohle von Gesellschaft und Gesellschaftern

 Rollentrennung als Schlüssel zum Erfolg
Rollentrennung als Schlüssel zum Erfolg In or Out?
In or Out?

 Der Erfolgsfaktor „Fremdmanager“
Der Erfolgsfaktor „Fremdmanager“ Gratwanderung zwischen Fluch und Segen
Gratwanderung zwischen Fluch und Segen Sicher durchs Minenfeld
Sicher durchs Minenfeld Allrounder mit hoher Sozialkompetenz
Allrounder mit hoher Sozialkompetenz
 Die schwierige Generationennachfolge
Die schwierige Generationennachfolge Aktives „Nachfolge-Management“
Aktives „Nachfolge-Management“ Ein bisschen mehr als nur Bauchgefühl…
Ein bisschen mehr als nur Bauchgefühl…