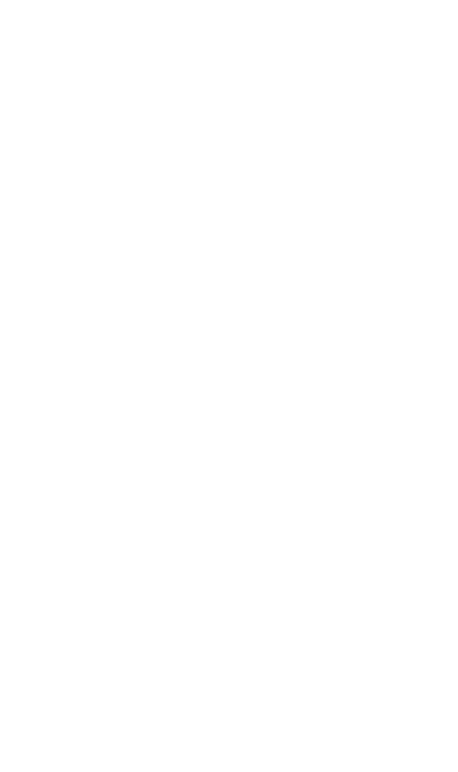Die Mischung macht’s
Warum „Agile“ nicht immer gut und „Hierarchie“ nicht immer schlecht ist
von Felix B. Waldeier
„Agile“ bzw. eine agile Transformation kann zu großem Erfolg aber auch Misserfolg und Chaos führen, wie verschiedene Praxisbeispiele im vorhergehenden Artikel („Agile: Wenn die Squad das Sagen hat“) von Dr. Christian Bühring-Uhle zeigen. Es wird daher die wenigsten überraschen, dass „Agile“ kein Allheilmittel ist. Gleichzeitig sollte man sich den neuen Ideen und Ansätzen gegenüber nicht gänzlich verschließen oder diese gar ignorieren. Aber warum?
Wir meinen, für bestimmte Aufgabenstellungen führt an agilen Management-Methoden kein Weg vorbei. Der Schlüssel liegt dabei in der Bedeutung und der daraus resultierenden, adäquaten Behandlung von Fehlern. Es gibt Aufgaben, insbesondere beim (Er-) Finden und Entdecken von neuen Lösungen, also überall dort wo es auf Kreativität und Innovation ankommt, wo Fehler eine wichtige Erkenntnisquelle sind. In solchen Aufgaben und Themen kommt man schlicht nicht voran, wenn man nichts Neues ausprobiert, dabei Fehler riskiert und aus Fehlern und Rückschlägen systematisch lernt. Hier ist der iterative „trial and error“-Ansatz agiler Techniken nicht nur hilfreich, sondern notwendig.
Es gibt aber auch Organisationen, deren Sinn und oberstes Ziel die Fehlervermeidung ist, bspw. Flugleitsysteme, Reaktorsicherheit, Technische Überwachungsvereine. Und in jedem Unternehmen gibt es Funktionen, bei denen Fehler einfach nur schädlich sind. Dort muss dementsprechend das Handeln – und das Management! – darauf ausgerichtet sein, Fehler zu eliminieren oder mindestens zu minimieren (bspw. in Funktionen wie Buchhaltung, Arbeitssicherheit, Produktsicherheit, Compliance). Selbst in der IT gibt es diesen Unterschied, denn innovative Software-Entwicklung folgt anderen Gesetzmäßigkeiten als der an der Einhaltung von Service-Leveln gemessene Betrieb einer IT-Infrastruktur. Die letztgenannte Art von Aufgaben, bei der es um die Vermeidung / Minimierung von Fehlern geht, erfordert ein hohes Maß an Überwachung und „linearen“ Management-Strukturen und eignet sich einfach nicht für „trial and error“ (was nicht heißt, dass man aus Fehlern, wenn sie denn geschehen, nicht lernen soll).
Wir glauben daher, dass in den allermeisten Organisationen, agile und herkömmliche Management-Prozesse und Strukturen nebeneinander existieren müssen. Die ständig zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit, der praktisch alle Unternehmen ausgesetzt sind, bringt es allerdings mit sich, dass „Agile“ immer wichtiger wird und sich praktisch kein Unternehmen erlauben kann, agile Techniken nicht zu erlernen. Wer Veränderungen nicht selbst vorantreibt, wird Getriebener der Veränderungen.
Die Herausforderung ist daher, die beiden Systeme, Führungsmethoden aber auch Kulturen „unter einen Hut“ zu bekommen. Die wenigsten Unternehmen sind „agile natives“ wie Spotify – oder so überschaubar und durch den Spirit unkonventioneller Gründer geprägt wie Freitag (siehe auch unser voriger Artikel). Für die meisten heißt es daher, einen neuen Modus Operandi zu etablieren. Da der Großteil der Unternehmen nach wie vor in Hierarchien organisiert ist, wird ein Wandel hin zu „Agile“ nicht funktionieren, in dem man einfach der bestehenden Organisation die „neuen Arbeitsweisen“ aufoktroyiert. Vielmehr gilt es drei wichtige Punkte zu beachten:
- Agile muss vorgelebt werden. Nur wenn das Top Management sich „Agile“ auf die Fahnen schreibt und ganz offen für diesen Wandel wirbt, kann es funktionieren.
- Die Mitarbeiter müssen involviert werden. Nur wenn diese von den Vorzügen der Flexibilität und Kundenorientierung überzeugt sind und sich ihre agilen Arbeitsmethoden selbst aussuchen, werden sie voll und ganz dahinterstehen und „Agile“ leben.
- Es braucht Zeit… unter anderem auch, weil „Agile“ die Unternehmenskultur – in vielen Fällen radikal – verändert. Man darf nicht nur die Ergebnisse des agilen Arbeitens sehen und messen, sondern muss auch die Art der Zusammenarbeit, Werte, Prinzipien und Stimmungen reflektieren, um bspw. eine Frustration des Teams zu vermeiden.
Die Unternehmensführung muss sich daher fragen: Wo ist es richtig und wichtig „agile“ zu sein und zu arbeiten? Und wo will/sollte man das bewusst nicht sein? Diese Unterscheidung und damit verbunden die Fähigkeit sowohl konventionell als auch agil zu agieren, muss das Top-Management vorleben. Es muss vorangehen und die Art des Arbeitens um agile Techniken erweitern. Das ist zweifelsohne und aus zweierlei Gründen eine Herausforderung: Zum einen wird es häufig nicht ein agiles Arbeiten gewesen sein, welches diese Personen in ihre Führungspositionen brachte – und zum anderen haben viele Vorstände nach 20 Jahren „Hierarchie“ nicht den Mut in ein Modell zu wechseln, in dem sie weniger Kontrolle haben, in dem Macht und Einfluss schwinden, in dem sie ihren Kollegen und Mitarbeitern mehr Verantwortung und Freiräume geben müssen – und in dem sie im Gegenzug selbst stärker unter Beobachtung von unten stehen. Doch soll „Agile“ funktionieren, müssen Unternehmensführer bereit sein eingefahrene Wege zu verlassen und eingeübte Verhaltensweisen zu „verlernen“, offen für Feedback sein, ein höheres Maß an Vertrauen entwickeln und akzeptieren, dass nicht alles vorhersehbar/planbar ist. Ebenso muss die Zusammenarbeit mit Kollegen und Mitarbeitern gestärkt, Entscheidungsbefugnisse an Mitarbeiter abgegeben und die eigenen Belange (oder die des eigenen Unternehmensbereichs) ganz klar hinter die der Gesamtorganisation gestellt werden. Nur wenn die gesamte Organisation sieht, dass die Unternehmensführung mit konkreten Aktionen vorausgeht, kann sich „Agile“ durchsetzen. Diszipliniertes, eigenverantwortliches Arbeiten nimmt hierdurch an Bedeutung zu – und muss auf allen Ebenen der Organisation gestärkt und kontinuierlich gelernt werden. Hinzu kommt die Notwendigkeit für ein hohes Maß an Klarheit in den Strukturen und Prozessen sowie der Koordination.
Natürlich kann man im Rahmen einer „Agile Transformation“ auch in Fallen tappen und insbesondere das Thema Disziplin kann zum Stolperstein werden. Wenn man nicht mehr kontrolliert wird, sich selbst organisieren muss, sich selbst Feedback geben muss etc., benötigt man mehr Disziplin. Es erfordert außerdem ein höheres Maß an Motivation und Initiative. Mit Personen, die nur richtig gute „Abarbeiter“ sind, aber immer einen Trommler brauchen, der den Takt vorgibt, Aufgaben zuweist und kontrolliert, wird agiles Arbeiten schwierig bis unmöglich. Insofern ist bei agilen Initiativen auch auf den konkreten Zusammenhang zu achten, was nicht nur unterschiedliche, mit Unternehmensfunktionen verbundene Teilkulturen betrifft, sondern auch die Geografie: Agiles, selbstbestimmtes Arbeiten wird Mitarbeitern in einem Land, in welchem individuelle Eigenarten und Freiheiten einen großen Stellenwert haben, leichter fallen als Menschen aus traditionell kollektiver und hierarchischer aufgestellten Gesellschaften.
Eine zentrale Frage in agilen Strukturen betrifft auch die Rolle und die Wichtigkeit des Top-Managements. Oder, noch konkreter: Wenn sich Mitarbeiter in Teams organisieren und mit erweiterten Freiheiten selbständiger arbeiten, benötigt man dann überhaupt noch einen Vorstand bzw. ein „C-Level“? Wir meinen, ja – nicht nur aufgrund verschiedener Fallbeispiele, in denen die Abschaffung des Vorstands zu großen Komplikationen führte. Wie oben ausgeführt, wird es auch in Zukunft in praktisch jedem Unternehmen noch hierarchische, von Top-Down-Kontrolle geprägte Funktionen geben – und geben müssen. Und insbesondere die Gesamtperspektive schließt eine komplett agile Organisations- und Arbeitsform für die meisten Unternehmen aus. Dies bedeutet im Umkehrschluss: Am Ende muss es jemanden (ein Individuum oder ein kleines Team von Individuen) geben, der den Inhabern und den sonstigen Stakeholdern (u.a. Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Gesamtgesellschaft) eines Unternehmens gegenüber für das Ganze individuell und persönlich „geradesteht“. Diese Verantwortung für das Ganze kann nicht aufgelöst und in eine Kollektivverantwortung aller – oder einer Gemeinschaft von Teamleadern – überführt werden. Mindestens in einem nicht ganz kleinen Unternehmen ist das Einnehmen einer Gesamtperspektive und einer Gesamtverantwortung ein „Full-Time-Job“ und entsprechend muss es ein Individuum (oder ein kleines Team) geben, das diese Verantwortung übernimmt. Und letztendlich muss auch die oberste Führungsriege, das C-Level eines Unternehmens, zumindest zu einem gewissen Grad, geführt werden: zwar mag jeder Vorstand seinen eigenen Verantwortungsbereich haben, aber eine Person, selbst wenn sie sich als Teamplayer und „Servant Leader“ versteht (siehe nachfolgendes Interview mit Pascal Houdayer) muss am Ende für dieses Team die Verantwortung tragen und „den Kopf hinhalten“.