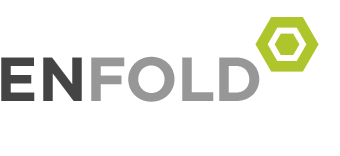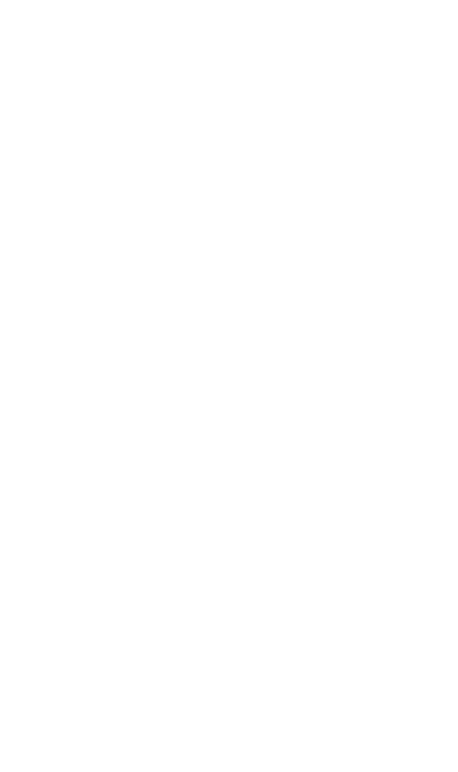Maßgeschneiderte Stiftungsarchitekturen als Ordnungsrahmen
Die Stiftung als Antwort auf die wachsende Komplexität in Unternehmerfamilien
Ein Gastbeitrag von Thorsten Klinkner
In Unternehmerfamilien mit gewachsenen Strukturen und generationsübergreifendem Anspruch genügt es nicht, Vermögen zu bewahren – es muss sinnvoll geordnet werden. Die maßgeschneiderte Familienstiftung ist dabei kein Instrument von der Stange, sondern ein Ordnungsrahmen, der durch klar definierte Governance die drei Ebenen Unternehmen, Familie und Vermögen in ein stabiles Verhältnis setzt.
Wo sich unternehmerischer Erfolg über Generationen mit familiärer Verantwortung und erheblichem Vermögen verbindet, entstehen Strukturen von großer Komplexität. Diese Strukturen entziehen sich oft einfachen Lösungen. Sie sind organisch gewachsen, geprägt von Zufällen, Charakteren und historischen Entscheidungen. Doch je länger diese Komplexität unbeachtet bleibt, desto fragiler wird die Ordnung – innerfamiliär wie unternehmerisch. In diesem Spannungsfeld gewinnt die Familienstiftung eine neue Rolle: nicht als Mittel zum Zweck, sondern als architektonisches Prinzip, das Ordnung stiftet, ohne Starrheit zu erzwingen. Eine klug konzipierte Stiftungsarchitektur vermag es, unterschiedliche Interessen, Systeme und Zeithorizonte so zu verbinden, dass aus Vielfalt ein funktionierender Zusammenhang entsteht. Entscheidend ist dabei nicht der formale Akt der Errichtung, sondern das Zusammenspiel dreier Governance-Ebenen, wie sie im Drei-Kreis-Modell der Familienunternehmen von Tagiuri und Davis aus dem Jahre 1978 entwickelt worden sind: Unternehmen, Familie und Vermögen. Jeder dieser Kreise schneidet dabei die jeweils anderen beiden Kreise, sodass die Überlappung dieser drei Kreise insgesamt sieben Bereiche ergibt.
Unternehmen: Stiftung als stabiler Eigentümer und die Logik der Corporate Governance
In der Unternehmenssphäre wirkt die Stiftung als Eigentümerin, nicht als Unternehmerin. Diese Differenzierung ist entscheidend, wenn es darum geht, strategische Handlungsfähigkeit mit langfristiger Stabilität zu verbinden. Der Begriff Corporate Governance beschreibt in diesem Zusammenhang die Gesamtheit der Regeln, Verfahren und Institutionen, durch die Unternehmensentscheidungen kontrolliert, gesteuert und überwacht werden. In inhabergeführten Familienunternehmen ist Corporate Governance zunehmend professionalisiert – durch Beiräte, Compliance-Strukturen und transparente Berichtspflichten. Doch wenn der Eigentümer selbst eine Stiftung ist, verschiebt sich die Perspektive.
Die Stiftung als Eigentümerin ist nicht emotional involviert, nicht persönlich haftbar und auch keinen natürlichen Alterungsprozessen unterworfen. Ihre Haltung zum Unternehmen ergibt sich nicht aus individuellen Präferenzen, sondern aus dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck. Diese Objektivierung des Eigentums ist eine ihrer größten Stärken – vorausgesetzt, sie wird mit der nötigen Sorgfalt ausgestaltet. Eine gute Stiftungsarchitektur übersetzt die Unternehmensstrategie in eine Governance-Struktur, die Verantwortung delegiert, Kontrollmechanismen etabliert und zugleich die Kontinuität des unternehmerischen Denkens sichert. Besonders wirkungsvoll wird die Stiftung, wenn sie nicht nur Anteilseignerin ist, sondern auch den Rahmen für Nachfolge und Führungsentwicklung vorgibt. Sie kann festlegen, unter welchen Bedingungen Familienmitglieder Führungsverantwortung übernehmen dürfen, welche Qualifikationen erwartet werden und wie externe Führungskräfte in das Gesamtgefüge eingebunden werden. Sie ermöglicht dadurch eine klare Trennung zwischen wirtschaftlichem Eigentum, operativer Führung und strategischer Kontrolle – ein Dreiklang, der in komplexen Familienunternehmen oft schwer zu erreichen ist.
Familie: Stiftung als Rahmengeberin und Family Governance als kulturelle Ordnung
Innerhalb der Familie ist die größte Herausforderung selten struktureller Natur, sondern emotionaler. Unterschiedliche Vorstellungen von Verantwortung, divergierende Lebensentwürfe und unausgesprochene Konflikte prägen viele Unternehmerfamilien spätestens ab der zweiten Generation. Gerade weil familiäre Bindungen starken Eigenlogiken folgen, braucht es einen Rahmen, der Orientierung schafft, ohne die Individualität zu unterdrücken. Dies ist der Kern der Family Governance – verstanden als bewusste Ordnung der familiären Beziehungen im Kontext des Familienunternehmens. Eine Familienstiftung kann diesen Rahmen institutionalisieren. Sie definiert, wer wofür zuständig ist, wie Entscheidungen vorbereitet und getroffen werden und unter welchen Bedingungen Unterstützung gewährt wird. Dabei ist Family Governance kein formales Regelwerk im engeren Sinne, sondern ein Ausdruck der gelebten Werte der Familie. Sie beantwortet Fragen wie: Welche Rolle spielt der Einzelne in der Familie? Welche Verantwortung geht mit der Zugehörigkeit einher? Was wird erwartet und was wird nicht toleriert?
In einer maßgeschneiderten Stiftungsarchitektur wird dieser kulturelle Rahmen konkret: durch Förderkriterien, durch Regelungen zur Beteiligung an Entscheidungsprozessen, durch gezielte Begabungsentwicklung und Bildungsunterstützung. Gute Stiftungen fördern nicht pauschal, sondern gezielt. Sie setzen Anreize zur Eigenverantwortung, statt Versorgung zu versprechen. Sie schaffen transparente Regeln, die der Familie helfen, sich selbst zu steuern. Dabei bleibt der Mensch im Mittelpunkt – nicht als Nutznießer eines Vermögens, sondern als Träger von Verantwortung im Rahmen eines größeren Ganzen.
Vermögen: Stiftung als Hüterin der Substanz und Foundation Governance als institutionelle Sicherung
In der Sphäre des Vermögens liegt der vielleicht intuitivste Einsatzbereich der Familienstiftung. Seit jeher dient sie dem Schutz großer Vermögen vor Zersplitterung, Fremdzugriff oder Veräußerung. Doch Vermögensschutz ist heute mehr als reiner Besitzstandswahrung. Er verlangt eine durchdachte strategische Allokation, professionelles Asset Management, klare Risikoüberwachung und die Fähigkeit, auf veränderte Rahmenbedingungen angemessen zu reagieren. Hier setzt die Foundation Governance an – als System der Kontrolle, Steuerung und Legitimation innerhalb der Stiftung selbst. Sie betrifft damit alle Fragen rund um die innere Ordnung der Stiftung: Wer sitzt in den Gremien? Wie werden Entscheidungen getroffen? Welche Kompetenzen sind delegiert, welche müssen abgestimmt werden? Eine leistungsfähige Stiftung zeichnet sich dadurch aus, dass sie kein starres Gebilde ist, sondern ein lernfähiges System. Sie muss institutionell so aufgestellt sein, dass sie Wandel gestalten kann, ohne ihren Kernauftrag zu gefährden. Gerade in Zeiten politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit wird diese Fähigkeit zum entscheidenden Vorteil.
Das Vermögen, das in der Stiftung gebunden ist, soll wirken – im Sinne des Stiftungszwecks, im Sinne der Familie, im Sinne unternehmerischer Verantwortung. Es darf nicht immobil werden, sondern muss zugleich geschützt und gestaltbar bleiben. Die Kunst der Stiftungsarchitektur liegt darin, diese Balance herzustellen. Durch differenzierte Anlagerichtlinien, klare Ausschüttungsmechanismen und eine Governance-Struktur, die Vertrauen schafft – sowohl innerhalb der Familie als auch bei externen Partnern, Banken und Beratern.
Praxisbeispiel: Familienstiftung als nachhaltiges Nachfolgemodell
Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis zeigt, wie wirksam diese Prinzipien umgesetzt werden können: Ein etabliertes Familienunternehmen in zweiter Generation – langjährig gewachsen, mit solider Marktstellung – stellt derzeit die Weichen für die Übergabe an die dritte Generation. Ziel der Familie ist nicht nur der Erhalt des Unternehmens, sondern eine bewusste Neuordnung auf der Eigentümerebene. Durch die Errichtung einer Familienstiftung soll das Unternehmen auf Dauer stabil geführt werden, verbunden mit einer klaren Trennung zwischen Eigentum und operativer Führung. Während die Familie ihre Gesellschafterrechte über die Stiftung organisiert und sich aktiv in den Organen engagiert, wird die Geschäftsführung schrittweise auf externe Führungskräfte übertragen. Diese Neuausrichtung wird in der Stiftungssatzung nicht nur rechtlich abgesichert, sondern kulturell getragen. Die Familie bekennt sich zum Unternehmen, aber nicht als operativ tätiger Gesellschafter, sondern als strategischer Eigentümer mit langfristiger Verantwortung. Entscheidungen wie etwa ein Unternehmensverkauf sind dort präzise geregelt und bedürfen definierter Mehrheiten in den Gremien. Zugleich wird die nachrückende Generation gezielt in die Verantwortung eingeführt: durch Beteiligung an der Familienversammlung, durch Aufgaben im Stiftungsrat, durch gemeinsame Entscheidungen über die Verwendung des nicht betriebsnotwendigen Vermögens, das in einem eigenen Aktiendepot innerhalb der Stiftung verwaltet wird.
Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, wie eine maßgeschneiderte Stiftung nicht nur juristisch, sondern auch emotional und kulturell tragfähig sein kann. Sie schafft Vertrauen, indem sie die Logiken von Familie, Unternehmen und Vermögen voneinander trennt und zugleich in ein gemeinsames Regelwerk überführt. Governance wird hier nicht als Kontrolle verstanden, sondern als Ermöglichung guter Entscheidungen – im Sinne des Ganzen.
Fazit: Die Stiftung als Ordnungskraft in der Komplexität